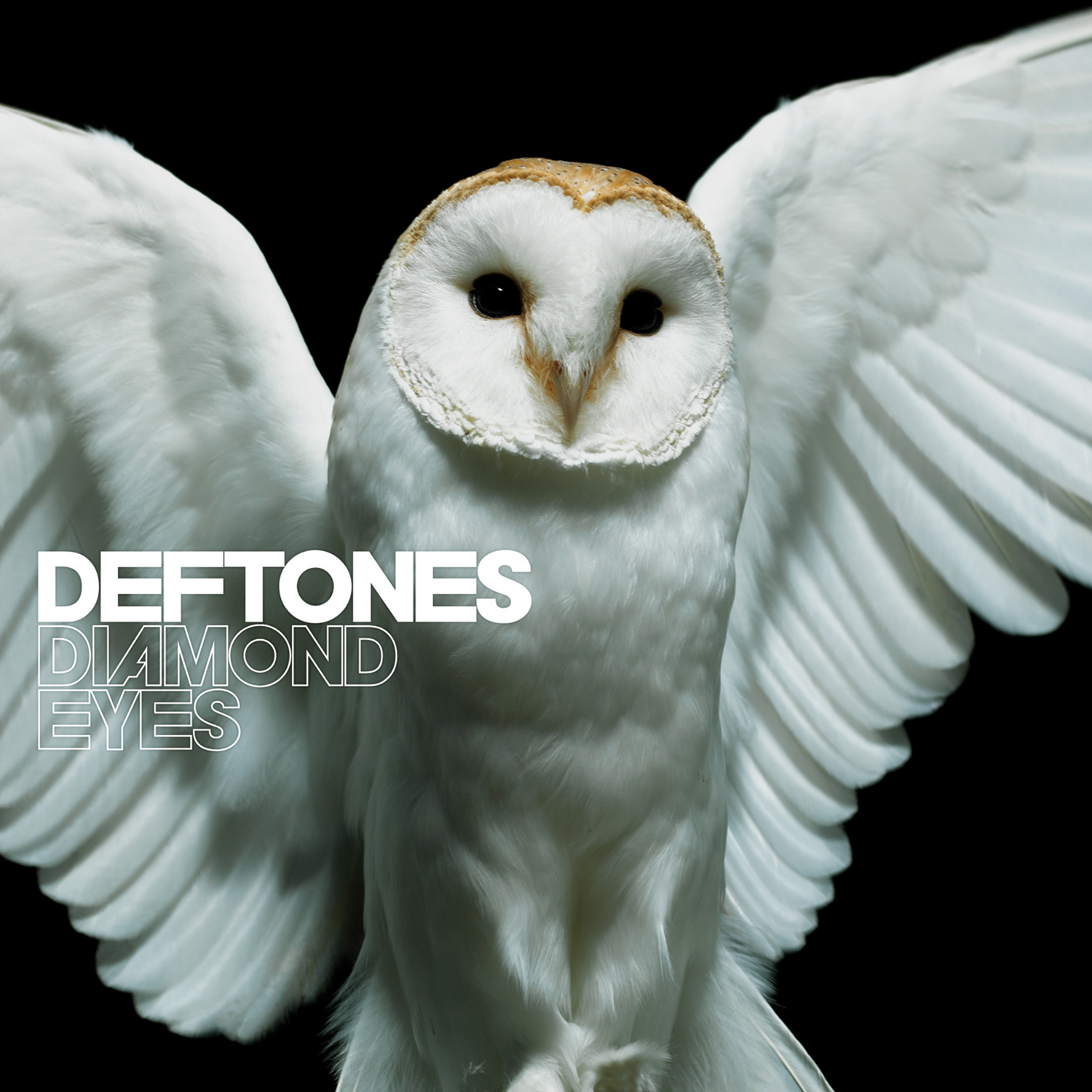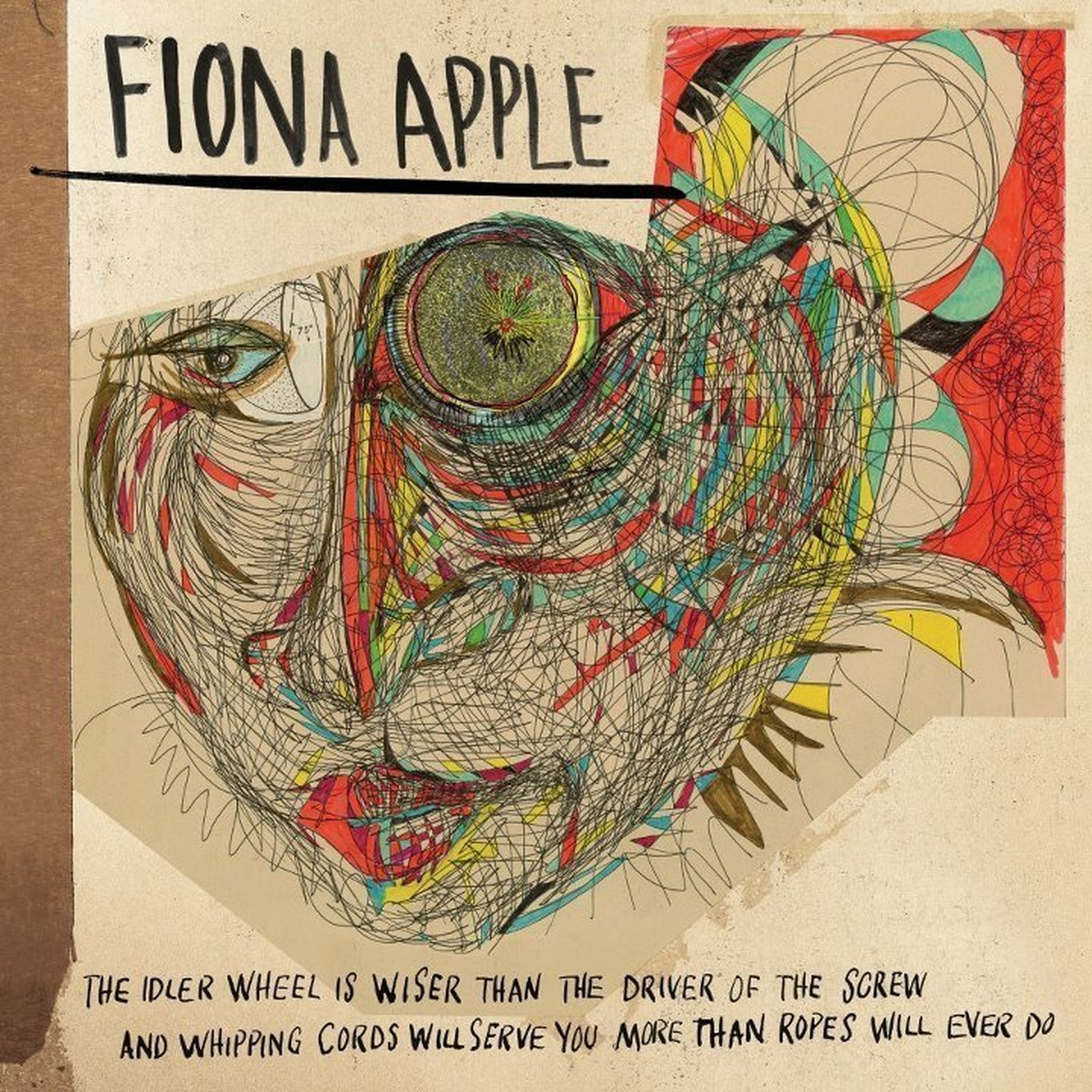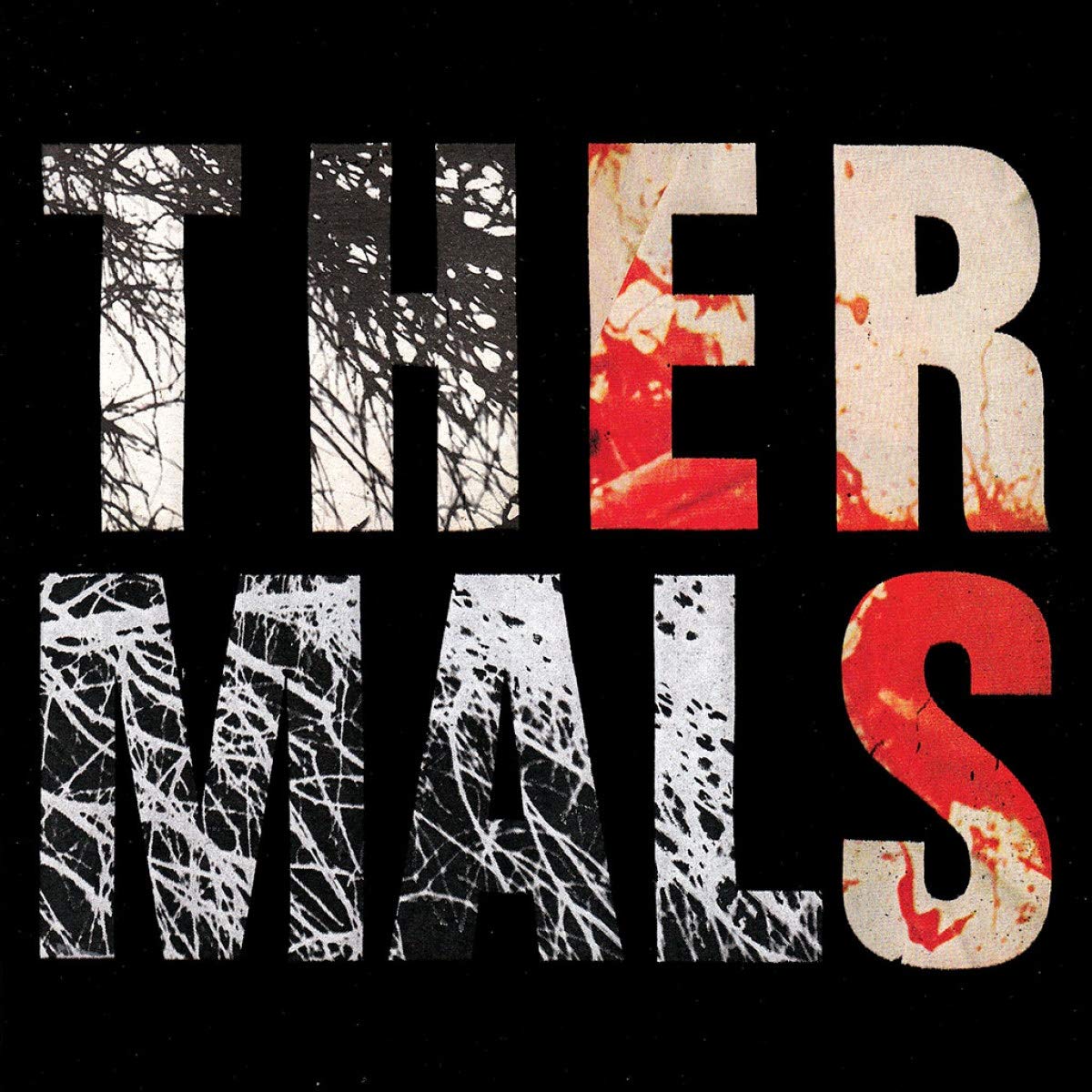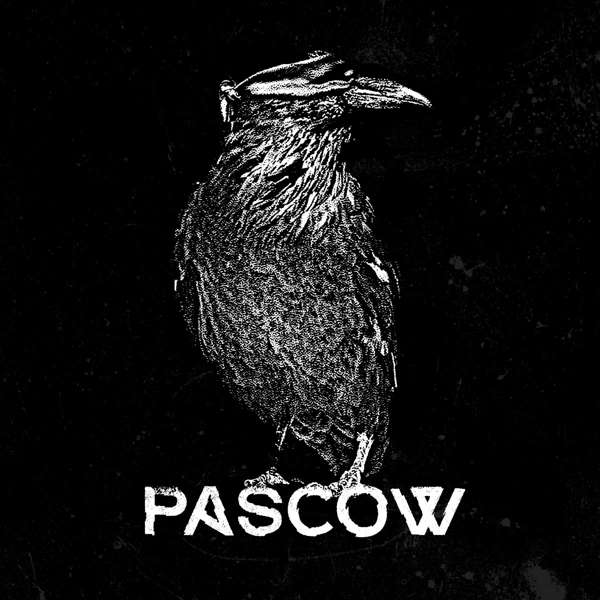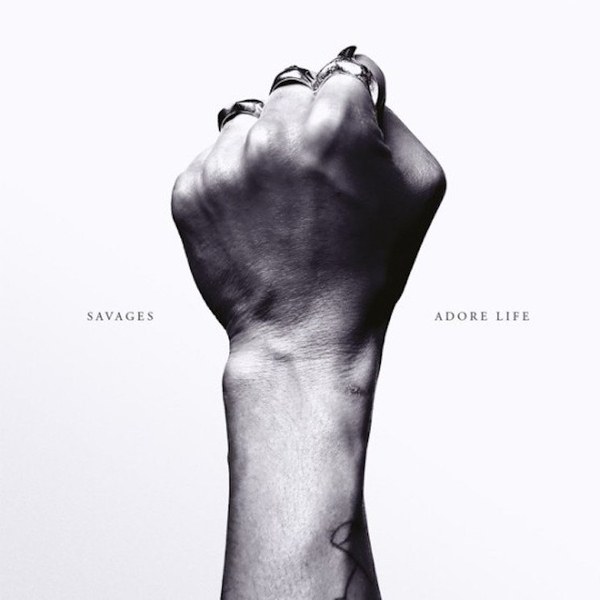100VÖ: November 2014 | Label: RCA
Acht Städte, acht Songs, ein Album: Dass Dave Grohl ein ruheloser Kreativkopf ist, muss man 2014 niemandem mehr groß erläutern. Mit “Sonic Highways” übertrifft er sich dennoch einmal mehr selbst und beantwortet die Frage, was die großen Stadion-Rockbands dieser Welt den 10er Jahren noch hinzuzufügen haben, mit einem Ausrufezeichen in Form eines Konzeptalbums. Jeder Song wird in einer anderen Stadt geschrieben und aufgenommen. Das Album ist dabei mehr als der Soundtrack zur zugehörigen HBO-Doku-Serie: Es präsentiert eine eingespielte Band, die sich durch die Spielarten des Rock gleiten lässt, sie zelebriert und sich in Form erhebender Gitarrensoli und flimmernder Orgeleinlagen vor ihnen verneigt. Das beginnt schon mit “Something From Nothing” und Grohls Worten “Give me the flammable life/ I’m cold as a match/ Ready to strike/ So here I go…”, bevor der Song inklusive Funk-Einlage von Cheap Trick-Gitarrist Rick Nielsen zu einem wilden Rocksturm aufbraust. Mit “What Did I Do / God As My Witness” liefert die Band ein durchkomponiertes, fast schon proggiges Meisterwerk, “The Clear” brilliert mit Bläsern zu typischen Foo-Fighters-Melodien, und mit Subterranean beschwört Grohls Gesang eine melancholisch meditative Stimmung, die das rocksinfonische “I Am A River” übernimmt. Trotz all der Verbeugungen vor der US-Rockgeschichte besteht keine Sekunde lang ein Zweifel daran, dass es sich hier um eine für sich stehende Foo-Fighters-Platte handelt. Diese Kombination macht “Sonic Highways” so einzigartig.
Juliane Kehr
99VÖ: September 2016 | Label: Jagjaguwar
Für viele Indie-Fans dürfte “22, A Million” den schwerwiegendsten Tabubruch des zurückliegenden Musikjahrzehnts darstellen. Was hatte sich Justin Vernon, der Folk-Liebling aus dem provinziellen, von schlechten Einflüssen eigentlich gut abgeschirmten Wisconsin, da erlaubt? Nach “Skinny Love” und zwei hinreißend schnuffeligen Indie-Folk-Alben, die ihm eine riesige Fan-Gemeinde bescherten, rückte er 2016 plötzlich von seinem schönen analogen Instrumentarium ab. Stattdessen gab es nur noch Songfragmente und Sound-Modulationen auf Synthie-Basis sowie zu allem Elend auch noch exzessiv eingesetzte Autotune-Effekte – Kanye West und Cher lassen grüßen. War das nun große Kunst oder großer Mist? War Vernon übergeschnappt, seinen Fans gegenüber undankbar oder doch ein Visionär, der seiner Zeit vorauseilt? Sicher ist, dass kaum ein Album der 2010er ähnlich vielen Hörern die Sinne geöffnet und sie an unbekannte Klänge herangeführt hat. Justin Vernon hat mit diesem Werk viel riskiert, und allein das verdient Respekt. Die Frage nach der Qualität des Albums lässt sich dabei bis heute auch deshalb nicht leicht beantworten, weil es nach wie vor zumindest in der ersten Hälfte wie eine Versuchsanordnung wirkt und wirkliche Vergleichswerte fehlen. Aber schon das kann man als Qualitätsmerkmal verstehen: Welcher andere Künstler hat sein Publikum so nachhaltig und erfolgreich herausgefordert? Den Weg von “22, A Million” geht Vernon 2019 weiter: Auch “i,i” fühlt sich in der Elektro-Indie-Avantgarde heimisch.
Christian Steinbrink
98VÖ: April 2013 | Label: Metal Blade
Zu Beginn des Jahrzehnts beschäftigen sich The Ocean auf “Heliocentric” und “Anthropocentric” kritisch mit dem Christentum, drei Jahre später veröffentlichen sie ein weiteres Prog-Post-Metal-Gesamtkunstwerk, das stimmiger nicht sein könnte. Unter anderem weil Band-Kopf und Hobbytaucher Robin Staps sein Label Pelagic Records nach dem Freiwasserbereich und seine Band nicht zufällig The Ocean benannt hat. “Pelagial” spielt in den Untiefen des Meeres, ein Beileger unterrichtet in Biologie und zeigt die verschiedenen Tiefenzonen. Man sieht schon hier, wie finster es 11.000 Meter unter der Wasseroberfläche, in der Benthic-Zone ist, wo jeder Sonnenstrahl lange verschwunden ist. Das gilt auch für das beruhigende Wassergluckern, für die Streicher und das träumerische Klavier, die das Album in “Epipelagic” noch in wenigen Metern Tiefe eröffnen, um danach im typischen wie gelungenen The-Ocean-Prog langsam, aber hoffnungsvoll abzudriften. In “Benthic: The Origin Of Our Wishes” ist davon nichts mehr zu spüren, hier regiert finsterer, schleppender Doom-Metal. Weil Loïc Rossetti sowohl abgrundtief schreien als auch melodisch singen kann, ist die Albumversion mit Gesang die bessere Wahl. Die instrumentale Variante, die anders abgemischt ist, zeigt hingegen, wie sehr The Ocean ihr Songwriting verfeinert haben. Beide Versionen gehören jedoch zusammen. Mit der beiliegenden DVD wird die Reise in die Tiefe außerdem optisch umgesetzt. Allumfassender und trotzdem auf den Punkt kann man ein Album kaum veröffentlichen.
Matthias Möde
97VÖ: April 2010 | Label: Reprise
“Diamond Eyes” muss man schon als Triumph verbuchen, weil es überhaupt existiert. In den Jahren zuvor taumeln die Deftones am Abgrund: Sie flüchten sich in Nebenprojekte und Drogen, dehnen die Produktion des oft unterschätzten “Saturday Night Wrist” (2006), zerbrechen daran fast, sind mit der eigenen Leistung unzufrieden, raufen sich für ein sechstes Album unter dem Arbeitstitel “Eros” zusammen und werden von der Zerbrechlichkeit des Lebens eingeholt, als Bassist Chi Cheng nach einem Unfall ins Koma fällt. Der Rest der Band legt das bislang eingespielte, der Legende nach ziemlich düstere Material auf Eis, engagiert als zunächst vorläufigen Ersatz Sergio Vega und schreibt mit “Diamond Eyes” ein weiteres sechstes Album, das die bisherigen Trademarks der Band neu abmischt. Im wahrsten Sinne des Wortes: Nick Raskulinecz verpasst der Band eine erstaunlich spröde Produktion, die diese mit brachial repetitiven Riffs (“CMND/CTRL”) auf der einen und schimmerndem Dream Pop (“Sextape”) auf der anderen Seite quittiert. In Stücken wie dem sinister-jazzigen “Prince” oder dem selbstzerfleischenden “976-Evil” geht beides zusammen, gerade weil es so unspektakulär inszeniert ist, der sonst so saftige Sound einfach ausgetrocknet. Wenn sich die alte Wucht wie im Titeltrack dennoch Bahn bricht, droht die Band fast abzuheben, so leicht wirkt ihre Musik mit einem Mal. Nachdem es sie kreativ beinahe zerrissen hätte, erstrahlen die neu justierten Deftones hier in frischem Glanz – bereit für weitere Großtaten in den 10er Jahren.
Sebastian Berlich
96VÖ: Februar 2010 | Label: Drag City
Wer sich bei seinen Platten für die einsame Insel für Joanna Newsoms “Have One On Me” entscheidet, handelt schon deswegen smart, weil das Dreifachalbum mit mehr als zwei Stunden Spieldauer viel Abwechslung unter der Kokospalme bietet. Auch Konvertiten sind diesmal zu Newsoms emotionalem Lagerfeuer eingeladen, denn die kunsthandwerkliche Überstrapazierung, die dem Vorgängeralbum “Ys” gelegentlich angekreidet wird, bleibt bei diesem großzügigen Nachschlag aus. Vor den Aufnahmen hat die Sängerin mit Stimmproblemen zu kämpfen, die für die tiefere Tonlage verantwortlich sind. Zusammen mit dem Piano, das streckenweise die berühmt-berüchtigte Harfe ersetzt, sorgt das für eine geerdete Produktion. Kompositorisch greift Newsom jedoch nach wie vor zu den Sternen, die 18 opulenten Songs enthalten ganze Welten, die ohne Zeitgefühl auskommen. “Have One On Me ist” auch deswegen so fesselnd, weil das Album keine Verweise kennt, die irgendeinen Trend symbolisieren könnten. Selbst wer dreimal nacheinander “Kate Bush” vor dem Spiegel sagt, kommt nicht weiter bei der Entschlüsselung von Songs wie “81” oder “Good Intentions Paving Co”. Dafür gibt es nur eine Methode: Die komplette Selbstauslieferung an eine Ausnahmekünstlerin, die selbst bei ihren turmhohen Ambitionen noch Sinn für Humor beweist. Den großzügigen Plattentitel könnte man sich so ähnlich auch von einer deutschen Thekenband vorstellen. Da hieße die Mammut-LP dann wohl “Das nächste geht auf mich” – und würde kein Stück so klingen wie Joanna Newsom.
Markus Hockenbrink
95VÖ: Juni 2012 | Label: Epic
Fiona Apples Motivation, sich an die Arbeit zu ihrem vierten Album zu machen, ist nicht besonders hoch. Die Platte zuvor, “Extraordinary Machine”, führte zu Disputen mit dem Label, die Plattenfirma verzögerte die Veröffentlichung, plötzlich tauchten die Songs im Netz auf, auch in unfertigen, aber besseren Versionen – am Ende verpufft das Album. Zögerlich macht sich Fiona Apple Ende der 00er Jahre an die Arbeit, neue Songs zu schreiben. Aber für was eigentlich? Für ein neues Album, ein Format, an das die Musikerin nicht mehr recht glauben mag – und dann auch noch weiterhin im Dienst eines Labels, dem sie nicht vertraut? Ein Wechsel auf dem CEO-Posten bei Epic führt zum Umdenken, sodass 2012 tatsächlich das vierte Fiona-Apple-Album einer Karriere erscheint, die bereits 1994 begonnen hat und mit Veröffentlichungen geizt. Der komplette Titel des Albums lautet: “The Idler Wheel Is Wiser Than The Driver Of The Screw And Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do”, wie schon auf ihrem zweiten Album “When The Pawn…” verwendet Fiona Apple Zeilen aus einem ihrer Gedichte. Zwar ist die Künstlerin wieder nicht glücklich, weil ihr diese Lieder schon zur Zeit der Veröffentlichung alt vorkommen. Aber die Fans sind happy: Dies ist Fiona Apples bestes Album. So eigenwillig sie auch klingen mag, aber man kann sich ihren Sound als Musik auf der Schnittstelle zwischen PJ Harvey und Tori Amos vorstellen – plus einer Prise Post-Rock, die ein Stück wie “Jonathan” zur Offenbarung macht.
André Boße
94VÖ: Mai 2015 | Label: Partisan
Als Torres mit ihrem zweiten Album bei VISIONS aufschlägt, ist dessen Bedeutung noch nicht zu erahnen. Nach einem soliden, aber etwas handzahmen Indie-Folk-Debüt hält die Redaktion eine Mini-Story für ausreichend. Am Ende des Monats steht Sprinter allerdings an der Spitze des Soundchecks, weil sich hier eine Singer/Songwriterin anschickt, das Erbe von PJ Harvey fortzuspinnen und auf textlicher Ebene die Schönfärberei so richtig auszuweiden: “What’s mine isn’t really yours/ But I hope you find what you’re looking for”, ist eine jener Zeilen, die selten wohlwollend gemeint sind. Dafür ist die Text/Sound-Schere zu plakativ, das Album zu sehr ein Spiel der Kontraste, aufgekratzt und verächtlich, und nur vermeintlich einfühlsam – aber genau dann am besten, wenn Grunge seine Giftspritzen tief in Singer/Songwriter-Stücke wie “Strange Hellos” oder “New Skin” injiziert. Bei zaghafteren Stücken wie “A Proper Polish Welcome” besitzt Mackenzie Scott, die sich nach ihrem Großvater benannt hat, auch mal die weiche Grandezza von Cat Power. Dennoch ist “Sprinter” nie die Sorte Album, auf das sich alle einigen können. Dafür ist es zu sehr Antithese, gegen sich und andere. Eines, das so sehr gegen die allgemeinen Motivations-Mantras ätzt, dass man dämlich grinsende Selbstoptimierer und ihre vorgegaukelte gute Laune nur noch müde belächeln kann. Auf dem Nachfolger “Three Futures” (2017) wendet sich Mackenzie dann ihrem Körper zu. Das klingt nicht unbedingt schlechter, aber doch ein gutes Stück verträglicher.
Daniel Thomas
93VÖ: April 2013 | Label: Saddle Creek
Wäre Rockmusik seit dem Millennium öfter so impulsiv und mitreißend gespielt worden wie auf Desperate Ground, sie hätte ihre gesellschaftliche Dominanz nie eingebüßt. Neben Japandroids und Cloud Nothings sind The Thermals die dritte wichtige Indie-Garage-Punk-Band, aus der das Genre in den 10er Jahren nochmal so richtig stürmisch herausbricht. Dabei schien das Trio schon domestiziert, klang “Now We Can See” (2009) gemessen am früheren LoFi-Charme unverschämt poppig, richtete “Personal Life” (2010) sich mit melancholischen Beiklängen nach innen. Und nun das: “I was born to kill/ I was made to slay” – so fangen Kriegserklärungen und Thrash-Metal-Brecher an, aber doch nicht Platten von Indie-Darlings aus dem hippen Portland! Viel Kritik gibt es für die brummige, rauschende, übersteuerte Produktion, dank der das Album klingt, als hätten ein paar Black Sabbath-Punks das Thermals-Debüt “More Parts Per Million” in ein Billig-Mikro gerotzt. Dabei transportiert gerade der angeschlagen glühende Sound perfekt die Emotionen, um die es hinter dem verbalen Gemetzel von Songs wie “Born To Kill” oder “The Sword By My Side” eigentlich geht: Was muss passieren, bevor jemand tötet? Und was macht das Töten mit einem? Weil die musikalische und textliche Vehemenz von “Desperate Ground” durchweg mit Hit-Melodien wie der von “The Sunset” einhergeht, hat die Band danach nichts mehr hinzuzufügen: Das wehmütigere “We Disappear” (2016) wird zur selbsterfüllenden Prophezeiung – The Thermals sind fertig, zwei Jahre später auch offiziell.
Dennis Drögemüller
92Pascow Diene der Party
VÖ: Februar 2014 | Label: Rookie
Für eine Punkband zwischen den Szenestühlen, die sich theoretisch immer wieder neu beweisen und verorten muss, nehmen sich Pascow relativ viel Zeit für ihre Platten. Das liegt an ihrer angenehm unaufgeregten “Bock muss es machen”-Attitüde, durch die die Band alle Entscheidungen rund um Aufnehmen und Touren filtert. Aber auch daran, dass Pascow keine halben Sachen machen wollen und im Fall von “Diene der Party” auch nicht können: 2013, das Entstehungsjahr der Platte, ist nicht leicht zu verdauen. In der Türkei und Brasilien gehen Menschen gegen korrupte Regimes auf die Straßen, die AfD verpasst nur knapp den Einzug in den Bundestag und Whistleblower Edward Snowden macht deutlich, wie viel Macht der Überwachungsstaat besitzt. Kurz: Ein Jahr wie gemacht für klare Ansagen. Da verlassen sogar die Profi-Verklausulierer Pascow mal den Metaphern-Pfad: In “Lettre Noir” bezieht die Band zu treibendem Viervierteltakt und angezerrten Gitarren deutlich Stellung gegen die völkisch-rechtsoffene Band Frei.Wild, während der ungewöhnliche Titelsong mitten auf dem Indie-Dancefloor die Leistungsgesellschaft abwatscht. Das trifft damals wie heute einen blanken Nerv. Vor allem, weil Pascow trotz ihrer deutlichen Message nicht auf Plattitüden zurückgreifen und im Vergleich zu den Vorgängern zwar gefälliger klingen, aber noch genauso kraftvoll zubeißen. Wer es so galant schafft, schlauen politischen Punk von der Kellerbühne auf die Tanzfläche zu zerren, hat sich seinen Platz in dieser Bestenliste mehr als verdient.
Florian Zandt
91VÖ: Januar 2016 | Label: Matador
Savages haben auf ihrem zweiten Album “Adore Life” nicht nur “ein Lied von zwei Menschen/ wie Liebe sich anfühlt”, sondern gleich zehn. Behält man im Hinterkopf, dass Sängerin Jehnny Beth, deren lyrisches Ich auf “Adore Life” alle Höhen und Tiefen der Liebe ausmisst, mit Johnny Hostile, dem Produzenten der Band, liiert ist, bekommt das Hören des Albums fast etwas Voyeuristisches. Die zentrale Frage stellt sie mit ihrer autoritären, an Siouxsie Sioux erinnernden Stimme im Titelsong: “Is it human to adore life?”. Manche Wissenschaften würden die Frage vermutlich verneinen, hört man aber dieses Album, möchte man Beth uneingeschränkt zustimmen, ob sie nun wie im Opener “The Answer” am Boden zerstört ist oder im folgenden Evil tradierte Konzepte von Liebe zu einem tanzbaren Disco-Groove gegen alle Widerstände infrage stellt: “So don’t try to change, don’t try to change/ The way they made you/ Don’t try to change, don’t try to change/ Or they will hurt you, they will break you down”. Man darf aber nicht den Fehler machen, “Adore Life” als One-Woman-Show zu begreifen, denn Gitarristin Gemma Thompson, Ayşe Hassan am Bass und Schlagzeugerin Fay Milton bereiten mit ihrem fiebrigen, reduzierten Post-Punk, der mindestens so smart gespielt ist wie Gang Of Fours “That’s Entertainment”, erst den Boden für Beths Dialektik der Liebe und der Liebenden. Dabei sind Savages nur eine von vielen Bands, die in den vergangenen zehn Jahren Rockmusik weiblicher gemacht haben – und das ist ganz bestimmt kein Schaden.
Florian Schneider
Inhalt
- Die 2010er: Die Plattenliste – Die 100 besten Alben der 2010er
- Die 2010er: Chronik eines Jahrzehnts – Blick zurück nach vorn






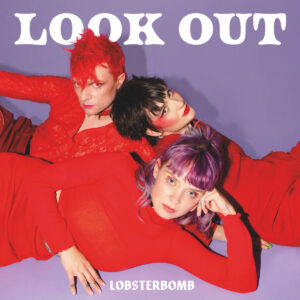






 Die 100 besten Alben der 2010er
Die 100 besten Alben der 2010er  Die 100 besten Alben der 2010er" title="
Die 100 besten Alben der 2010er" title="