Christof, was hat dich dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben?
Ich suche mir für meine Bücher Themen, über die ich selbst gerne mehr erfahren möchte. In diesem Fall kam der Zufall ins Spiel: Ich habe in einem Artikel über Die Sterne in einem Nebensatz gelesen, dass die Band ganz am Anfang Teil von Fast Weltweit war, einen kleinen musikalischen Kosmos aus Bad Salzuflen. Einer Kleinstadt, einem Kurort. Das weckte sofort mein Interesse. Ich recherchierte ein wenig im Internet, fand knappe Einträge mit allerhand Namen: Bernadette La Hengst, Bernd Begemann, Jochen Distelmeyer. Danach habe ich bei Frank Werner angerufen, Initiator des Labels, der auch weiterhin die Website pflegt und ein wenig die Rolle des Bewahrers einnimmt. Von ihm habe ich weitere interessante Geschichten erfahren, sodass mir irgendwann der Gedanke kam: Jetzt versuche ich das mal mit dem Buch.
Was war der nächste Schritt?
Ich habe zuerst sehr viel Musik aus dieser Zeit gehört, und vieles von dem fand ich toll und außergewöhnlich. Dann begann ich damit, verschiedene Leute anzuschreiben, die damals dabei waren, verbunden mit der Frage, ob sie nicht Lust hätten, bei dem Buch mitzumachen. Es kamen sofort sehr viele positive Rückmeldungen. Also konnte es losgehen. Es gab zunächst den Plan, die Clique von damals noch einmal in der Garage von Frank Werner zu versammeln, dem Ort, an dem alles begann, weil er damals das Studio und die Zentrale von Fast Weltweit war. Es hat sich aber schnell gezeigt, dass das nicht funktionieren wird. Die meisten Protagonisten spielen ja noch heute in Bands, sind dauernd auf Tour oder im Studio – unmöglich, da einen Termin zu finden. Eine Möglichkeit wäre gewesen, eine feste jährliche Verabredung der Clique zu nutzen: Einmal im Jahr versammeln sich viele von ihnen bei einem Osterfeuer neben der Gärtnerei, die Frank Spilkers Eltern und sein Bruder in Bad Salzuflen betreiben. Dann wurde das Osterfeuer aber abgesagt. Daher habe ich Einzelgespräche mit den Leuten geführt.
Du erzählst die Geschichte von Fast Weltweit als Oral History, also entlang von Zitaten der vielen Gesprächspartner. Warum hast du dich für diese Form entschieden?
Ich habe vor vielen Jahren mit großer Begeisterung “Verschwende deine Jugend” von Jürgen Teipel gelesen. Ich fand klasse, dass man das Gefühl hatte, die Leute sitzen sich beim Austausch ihrer Erinnerungen gegenüber, unterhalten sich über die alte Zeit und werfen sich dabei die Bälle zu. Für mich war diese Form viel nahbarer, als wenn Teipel das aus seiner Sicht aufgeschrieben hätte. Hinzu kam, dass sich für dieses Projekt kein Hauptprotagonist anbot. Das war bei meinen früheren Büchern anders, da gab es zum Beispiel Nikel Pallat, den Manager von Ton Steine Scherben, der die ganze Geschichte erzählen konnte. Dieser Ansatz ist bei “Fast Weltweit” nicht sinnvoll, weil sich die Story ja vor allem durch die besondere Dynamik in der Gruppe ergibt. “Fast Weltweit” ist eine Kollektivgeschichte.
Was auch die vielen Gruppenfotos im Buch zeigen.
Genau. Später, als viele dieser Leute zu Protagonisten bei der Gründung der so genannten Hamburger Schule wurden, haben sich eigentlich alle dagegen gewehrt, von diesem Namen vereinnahmt zu werden. Das war in Bad Salzuflen anders. Man hat sich sehr bewusst als Gruppe verstanden – und auch so gezeigt.
Fast alle Protagonisten sind dabei, nur der bekannteste Name fehlt: Jochen Distelmeyer. Wie schmerzhaft ist es für ein solches Projekt, dass er nicht dabei ist?
Als klar war, dass er nicht teilnehmen möchte, dachte ich schon: “Mist”. Es wäre schon schön gewesen, weil er einen großen Namen hat und es sehr interessant gewesen wäre, seine Sicht zu erfahren. Im fertigen Buch fehlt er aber, wie ich glaube, gar nicht so sehr. Es gibt einige Interviewausschnitte aus Zeitungsartikeln, in denen er sich zu Fast Weltweit äußert. Das zu integrieren, fand ich wichtig. Zusätzlich gibt es die Einschätzungen der anderen, die über ihn sprechen. Wobei man auch sagen muss: Es gibt in diesem Kosmos von Fast Weltweit Leute, die wichtiger waren als er. Jochen Distelmeyer kam erst später dazu, war nur gut zwei Jahre dabei, bevor er zusammen mit Frank Spilker nach Hamburg ging und die beiden dort in einer WG lebten.
Eine interessant Stelle im Buch: Distelmeyer lebte in Brake, einem Stadtteil von Bielefeld, 20 Autominuten von Bad Salzuflen entfernt. Über die Fast-Weltweit-Leute in seiner Nachbarschaft, die genau seinem Mindset entsprachen, erfuhr er aber erst durch einen Artikel in der Spex.
Es war halt noch die Zeit vor den Internet. Da war eine Entfernung von 20 Autominuten eine ganze Welt.
Hätten sich die Leute von Fast Weltweit gefunden, wenn es damals schon das Internet gegeben hätte?
Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich glaube, dass sich diese kreativen, kleinen und lokalen Szenen auch deshalb bilden konnten, weil es die Vernetzung über das Internet noch nicht gab. Heute ist es sehr einfach, über das Internet Gleichgesinnte aus der ganzen Welt zu kontaktieren, mit ihnen Musik zu teilen oder selbst Sachen aufzunehmen. Fast alle Protagonisten meinten, dass sich Fast Weltweit in Bad Salzuflen auch deshalb formierte, weil es diese Möglichkeiten damals noch nicht gab. Es brauchte diesen konkreten Ort in Frank Werners Garage, und es brauchte auch den Moment, dass dieser sich ein Aufnahmegerät zulegte, sodass aus der Garage eine Art Studio wurde.
Gelegenheit machte Szene.
Genau, was im Umkehrschluss bedeutet, dass sich solche kreativen Zellen heute deutlich seltener finden. Was schade ist, denn dadurch gehen kreative Prozesse verloren.
Kommen wir zur Musik: Was kennzeichnet den Sound, der damals bei Fast Weltweit entstanden ist?
Im Kern waren das Singer/Songwriter, denen der Text wichtiger war als die Ausgestaltung der Musik. Weshalb sie auch auf Deutsch gesungen haben. Auch deshalb war Distelmeyer zunächst ein Außenseiter, weil er ganz Beginn auf Englisch getextet hatte, was die anderen erst einmal befremdlich fanden. Musikalisch wurde viel experimentiert, wobei sich zeigte, dass diese Leute eine recht steile Lernkurve hatten: Die Sachen wurden schnell immer besser. Wobei man auch sagen muss: Es handelte sich hier nicht um musikalische Supertalente. Die Musik ragte deshalb heraus, weil sie zusammen mit der Haltung und den Texten eine sehr besondere Mischung ergab.
Warum deutsche Texte? Es handelt sich um eine Zeit kurz nach der Neuen Deutschen Welle, als viele andere Indie-Musiker wie Sven Regener von Element Of Crime oder Phillip Boa auf keinen Fall auf Deutsch singen wollten, um sich möglichst vom NDW-Sound zu distanzieren, der damals nach Albernheit und Ausverkauf roch.
Die Texte waren den Leuten von Fast Weltweit so wichtig, dass sie gesagt haben: Wir können nur in der Sprache singen, die wir auch sprechen. Alle waren große Fans von Fehlfarben, aber auch von den Smiths und Buzzcocks und wussten: Wenn wir mit unseren Texten ähnlich berühren wollen, dann müssen wir in unserer Muttersprache texten, um uns so auszudrücken, wie wir das möchten. Viele der Protagonisten machen bis heute erfolgreich Musik. Daran zeigt sich, dass sie mit ihrer Einschätzung recht hatten. Es gab und gibt in Kleinstädten unzählige solcher lokaler Szenen, in denen sich junge Leute einige Jahre lang in einer Garage treffen, Bierkisten weghauen und Punkrock spielen. Dann aber kommt das Abi, beginnt man zu studieren, wechselt die Stadt, verliert sich aus den Augen – und Musik spielt keine Rolle mehr. Das war bei vielen von Fast Weltweit anders.
Es gibt aber auch Leute, die aufgehört haben.
Ja, Michael Girke, der damals die Band Jetzt! gründete, hat sich irgendwann gesagt: Das ergibt nun für mich keinen Sinn mehr, ich muss ja schon auch regelmäßig Geld verdienen. Auch Andreas Henning, einer der Gründer von Fast Weltweit und Chef der Time Twisters, hat sich irgendwann bewusst gegen die Musik entschieden. Und Frank Werner, ohne dessen Garage und Aufnahmegerät es Fast Weltweit nicht gegeben hätte, verdient sein Geld sein Jahren in der IT-Welt.
Anfang der 90er zogen dann Teile der Clique nach Hamburg, waren dort am Gründungsmythos der Hamburger Schule beteiligt. Über diese gab es im vergangenen Jahr eine heiße Debatte: Nach einer ARD-Doku wurde mit größter Erregung darüber diskutiert, wer damals welche Rolle gespielt hat. Was passierte damals in Hamburg?
Ich glaube, dass der Ernst des Lebens Einzug erhielt. Es ging nun darum, eine eigene Karriere aufzubauen, eigene Wege zu gehen. Was automatisch dazu führte, dass die Gemeinsamkeiten von früher verloren ging. Zumal in Hamburg neue Akteure ins Spiel kamen, die Goldenen Zitronen zum Beispiel. Mit denen kam jemand wie Bernd Begemann überhaupt nicht klar, sodass es zu Zerwürfnissen kam. Frank Spilker mit Die Sterne und Jochen Distelmeyer mit Blumfeld haben sich auch bewusst vorgenommen, mit der Musik, die sie mit Fast Weltweit gemacht haben, zu brechen. Beide gingen weg von den Singer/Songwriter-Sachen, hin zu einer Musik, die auf Slogans und Parolen setzt, die musikalisch bei den Sternen auf Soul und Funk aufbaut, bei Blumfeld auf Indierock amerikanischer Prägung.
Für Leser, die noch nichts von Fast Weltweit kennen: Mit welchen drei Songs sollte man anfangen?
Man sollte sich unbedingt die Time Twisters anhören, die machen wirklich gute Laune, spielten lässigen Rock’n’Roll mit deutschen Texten. Der Song “Porsche-Girl” ist ein guter Startpunkt. Dann Jetzt!, die Band von Michael Girke. Die alten Aufnahmen sind vor einigen Jahren erstmals in guter Qualität veröffentlicht worden…
…mit dem Song “Kommst du mit in den Alltag?”, den Blumfeld später gecovert haben…
…genau, empfehlen möchte ich aber auch das Stück “Meine stille Generation”, das mit seinem sehr guten, wenn auch etwas verkopften Text für das steht, was Fast Weltweit ausgezeichnet hat. Und als Drittes das Lied “Bad Salzuflen weltweit” von Bernd Begemann, das viel von dem vermittelt, wie diese Kleinstadt damals war, und warum diese Leute sehr eindeutig festgestellt haben: Wir müssen hier raus, wir müssen etwas Anderes machen.



 Kommst du mit in den Alltag
Kommst du mit in den Alltag  Kommst du mit in den Alltag" title="
Kommst du mit in den Alltag" title="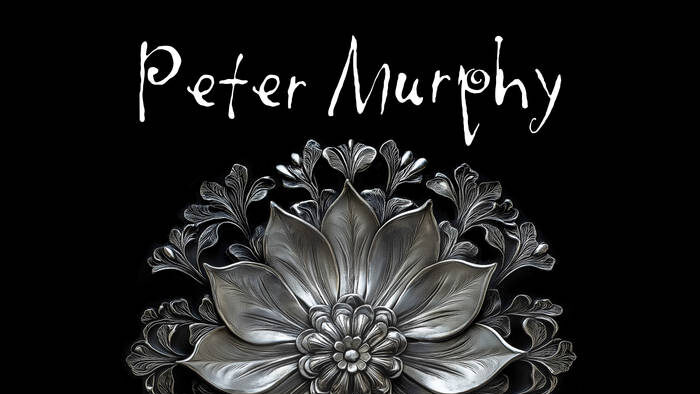
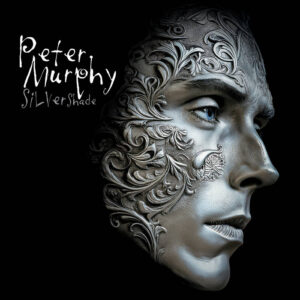


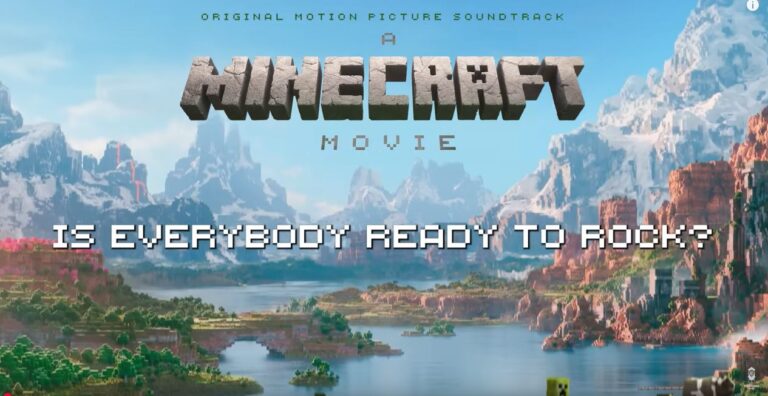

 Ganz bei sich" title="
Ganz bei sich" title="



