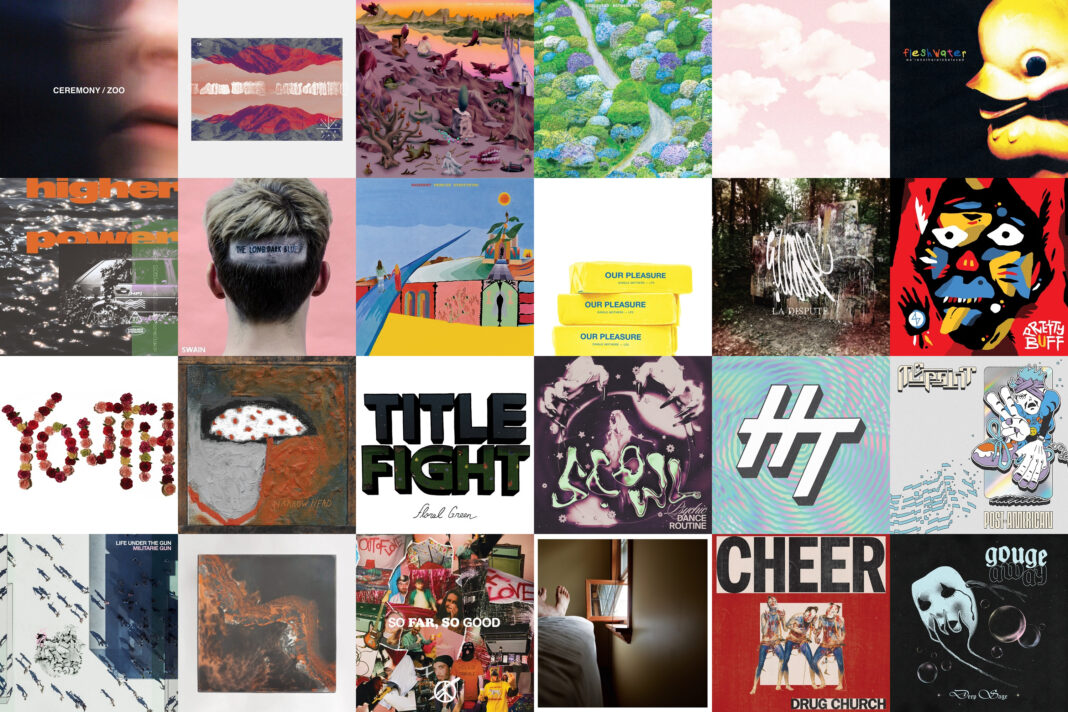Touché Amoré Parting The Sea Between Brightness And Me

Ihr zweites Album umfasst zwar nicht mal 21 Minuten, doch Touché Amoré vertonen in den darauf enthaltenen 13 Songs viele bedeutsame und persönliche Zeilen, die ihre Fans inbrünstig mitschreien, im Herzen oder unter der Haut tragen. Ihr Verfasser Jeremy Bolm wird damit in den kommenden Jahren zu einer tragenden Figur des modernen Hardcore – als Musiker, Texter und glühender Musikfan. Der Opener “~” geht auf dem Album auch thematisch voran und scheut keine Zerbrechlichkeit: “I’m parting the sea between brightness and me/ Before I drown myself and everyone and everything”. Selbstzweifel sind ein großes Thema, das Bolm mit verzweifelt trotziger Stimme perfekt transportiert und das die Band mit auf- und abebbenden Rhythmen, mit lauten Ausbrüchen (Blastbeats!) und wohl dosierten Melodien wunderbar vertont. In “Condolences” sinniert Bolm – schreiend und nur von einem Klavier begleitet – über seine eigene Beerdigung und die immense Bedeutung der dabei gespielten Musik. Ein gutes Sinnbild für die emotionale Wucht seiner Band.
Matthias Möde
La Dispute Wildlife

Genrezuschreibungen wie Modern- oder Post-Hardcore greifen bei La Disputes zweitem Album deutlich zu kurz. Man könnte Prog und Mathrock als Elemente ergänzen und wäre noch nicht beim Kern. Die 14 Songs auf “Wildlife” sind Kurzgeschichten, für die Sänger Jordan Dreyer Figuren erschaffen hat, durch die er spricht. Eine davon ist der Kurzgeschichten-Autor, der Dreyer zum Teil entspricht. Realität und Fiktion verschwimmen also in diesem Konzeptwerk, dessen emotionaler Höhepunkt zweifellos das fast siebenminütige “King Park” ist. In mehreren Akten und mit intensiver Dramatik steuert der Song auf die eine Zeile zu, mit der Dreyer mittlerweile seine Schwierigkeiten hat, weil sie ohne Kontext den Sinn verfälscht: “Can I still get into Heaven if I kill myself?” Der Frontmann hat ohnehin viel mehr zu erzählen – ob singend, schreiend oder sprechend. Egal wie wechselhaft die Rhythmen sind oder wie stürmisch die Gitarren klingen, Dreyers Stimme ist stets so präsent, dass sich daran selbst die Geister scheiden, die der emotionale Hardcore rief.
Matthias Möde
Pianos Become The Teeth The Lack Long After

Für die Band aus Baltimore ist Hardcore von Beginn an ein Ventil, um emotionale Schieflagen oder innere Leere mit Schreien und Schwermut zu füllen. So sind Kyle Durfeys Texte für Pianos Become The Teeth zutiefst persönlich: 2009 handelt das Debütalbum “Old Pride” davon, wie er versucht, mit der Multiple-Sklerose-Erkrankung seines Vaters umzugehen. Zwei Jahre später dreht sich “The Lack Long After” um den Tod seines Vaters und um die Trauer, mit der Durfey zu kämpfen hat. Die Songs schleppen sich ohne Refrains, aber lautstark voran, und Durfey schreit so verzweifelt und vehement, dass man manchmal fast zu nah dran ist. Das gilt insbesondere für das finale “I’ll Get By”, in dem er seinem Vater verspricht klarzukommen, aber nicht wirklich überzeugen kann, untermalt von marschierenden Drums und melancholischen Gitarren. Und so kündigt der Song mit seinem Emo-Sound nicht nur den musikalischen Wandel auf “Keep You” (2014) an, sondern auch die Tatsache, dass Durfey darauf weiterhin trauert, aber nicht mehr schreit.
Matthias Möde
Ceremony Zoo

Über drei Alben im Zwei-Jahres-Takt kultivieren Ceremony aus Rohnert Park, einer Planstadt in Kalifornien, ihren an Black Flag und Circle Jerks geschulten Hardcore-Punk-Sound. Wieder zwei Jahre später inszenieren Ceremony sich auf “Zoo” neu. Das ist zwar immer noch Hardcore-Punk, aber die Soundästhetik hat sich verändert. Der eröffnende Brecher “Hysteria” legt einige Pfunde drauf, die im Folgenden wieder abgenommen werden. Die zwölf Songs widersprechen Erwartungen und die klassischen Strukturen. Ceremony sind hier immer wieder näher am Garage- und Punk-Gestus von Bands wie The Gun Club und The Black Lips. Das ist so irritierend wie interessant, aber vor allem: überraschend. Die Gitarren sind meist clean, der Sound fettarm, Ceremony sind deutlich in den 80ern angekommen. Einminütige Hardcore-Salven sind nicht mehr dabei, dafür Midtempo und gelegentlich sogar Melancholie, etwa in “Hotel”. Im abschließenden “Video” geht es dann zum unterkühltem Post-Punk – eine Richtung, die Ceremony in der Folge beibehalten.
Jan Schwarzkamp
Title Fight Floral Green

Die Zeiten für Hardcore sind Anfang der 2010er ungewiss zwischen Szenekodex, Selbstentfaltung und Lautstärke-Dogma. Auf “Floral Green” wachsen Title Fight über Hardcore hinaus – und direkt in den Nebel der Post-Genres. Auch auf “Shed” ist die Band um Sänger Ned Russin zwischen Wut und Melodie getaumelt, doch mit ihrem zweiten Album wagen sie mehr Atmosphäre, mehr Schmerz, mehr Mut zur Leere. Gitarren flirren, Stimmen schleppen sich durch Hall. Ist auf dem Vorgänger noch alles auf Kante genäht, dürfen die Songs auf “Floral Green” atmen. Das ist kein Bruch, sondern ein Schmerzprozess voller Überwindungsversuche. “Head In The Ceiling Fan” flackert durch den Dunst und wird zum Aushängeschild der Band. Depression in den Zeilen, Pop im Hinterkopf, Hardcore als Grundgefühl und Shoegaze, der sich herauskristallisiert: Für viele wird “Floral Green” so zum Einstieg in den Hardcore, ein Fenster für Melancholiker:innen ohne Szeneanschluss – und in Folge der “Wave” ein Schlüsselwerk des Post-Hardcore.
Bea Gottwald
Citizen Youth

Citizen laden ein, sich gemeinsam in der Misere zu suhlen. Nachdem die Band aus Ohio 2012 bei Run For Cover landet, veröffentlichen sie wenig später ihre Debüt-EP “Young States”, bereits knapp ein Jahr später feiern sie mit “Youth” den Durchbruch und landen gleich einen Klassiker in der Emo-Revival-Szene. Mit einer einmalig beklemmenden Atmosphäre fängt das Album die Sorgen und die Ängste ein, die mit der Jugend und dem frühen Erwachsensein einhergehen, und verbindet modernen Hardcore mit der Rührseligkeit des Emo der 90er und eingängigem Alternative Rock. Währenddessen brüllt sich Mat Kerekes – stets im Mix zurückgenommen – den Frust von der Seele und lädt eine ganze Generation ein, es ihm gleichzutun und für 30 Minuten die depressiven Phasen voll auszukosten. Zeilen wie “I should’ve crashed the car/ The night I drove alone” gehen noch zehn Jahre später unter die Haut. Dass auch hier Will Yip seine Finger im Spiel hatte, liegt eigentlich auf der Hand.
Nicola Drilling
Basement Promise Everything

Mit “Colourmeinkindness” prägen Basement 2012 die Hochphase des Emo-Grunge entscheidend mit und knibbeln an einem Hardore-Nerv herum, den auch Title Fight oder Balance And Composure treffen. Danach ist erstmal Schluss. Auch, weil sich die Band in alle vier Winde zerstreut. Umso erstaunlicher, dass die Quasi-Reunion-Platte vier Jahre später so aus einem Guss, so frisch und luftig klingt. Schwermütigen Grunge tauscht die Band darauf an vielen Ecken gegen Alternative mit dezidiertem UK-Touch in der Tradition von Suede oder Pulp. Sänger Andrew Fisher bewahrt sich neben soften Melodien auch seinen Raspelgesang, selbst wenn das Instrumental mit dem Pop flirtet. Das hört man etwa im zurückgelehnten “Oversized”, bevor Basement zwei Songs später wieder Richtung swingenden Emo driften und mit dem darauffolgenden Titelsong ordentlich Dampf machen. “Promise Everything” ist das ideale Comeback, das für seine Sound-Neustrukturierung mal nicht in die USA, sondern auf die heimische Insel schielt.
Florian Zandt
Swain The Long Dark Blue

Einen Kumpel zu finden, der sich deinen Albumtitel auf den rasierten Hinterkopf tätowiert, ist schon ziemlich hardcore. Genau wie nach acht Jahren seinen Bandnamen abzustoßen und statt Sludgecore plötzlich Alternative-Grunge-zu machen. Diese Scheiß-drauf-Attitüde, mit der Swain einige Fans vergrault haben dürften, zieht sich komplett durch “The Long Dark Blue”. Kern der Platte ist “Punk-Rock Messed You Up, Kid”. “High school messed you up, kid/ Parents messed you up/ Drugs messed you up, kid/ Punk-rock messed you up”, keift Frontmann Noam Cohen zu psychedelischen Gitarrenriffs, bevor er “Feel just fine with this past of mine/ Punch my guts, grow me spine” säuselt. Es passt perfekt, dass die erste Platte unter dem neuen Namen vom Post-Hardcore-Guru J. Robbins (Jawbox) produziert wurde, der die Weirdo-Vibes aus Songs wie “It’s Hard To Make Friends” und “You’re Not Special” herauskitzelt. “The Long Dark Blue” ist ein Meilenstein des europäischen Post-Hardcore zwischen Grunge, Punk und psychedelischen Riffs.
Florian Zandt
Single Mothers Our Pleasure

Drew Thomson ist niemand, auf den man sich verlassen sollte. Bei Single Mothers hat er über 30 Bandmitglieder verschlissen, jede Tour ist angeblich die letzte, jedes Album sowieso. Doch bevor die “Band” überhaupt erst Fahrt aufnehmen kann, verzieht sich Thomson in die kanadische Wildnis zum Goldschürfen und um eingängige Indiefolk-Songs zu schreiben. Auf dem Debüt “Negative Qualities” von 2014 ist davon nichts mehr zu hören. Das ist entfesselter Hardcore für frustrierte Teenager mit Black Flag-Tattoos, die sich ihre Zeit mit Dosenstechen und Skateboards vertreiben. Der Nachfolger “Our Pleasure” bleibt chronisch unzuverlässig mit Midtempo-Anger-Management über gescheiterte Beziehungen und allem, was Thomson sonst nicht auf die Kette kriegt, über zerfahrenen 90er-Indie-Melodien. “I liked the older shit/ Whatever happened to Single Mothers?”, fragt Thomson in “High Speed” und lacht sich ins Fäustchen. Auf den nächsten Alben wird er mit Electro, Post-Punk und Heartland Rock alle Zweifler zur Verzweiflung treiben.
Jonas Silbermann-Schön
Drug Church Cheer

Auf der Bühne ist Patrick Kindlon ein Freund anständiger Stagedives und hält auch bei Drug Church sein Publikum auf Trab. Tough-Guy-Hardcore-Sportsfreunde haben sich mit Kindlon allerdings den falschen Prediger ausgesucht. Stumpfe Slogans über Zusammenhalt oder noch stumpfere Breakdowns wird man in dieser Kirche nicht finden. Wie schon bei Self Defense Family sprechschreit Kindlon hochzynische Geschichten, deren Botschaften sich nicht auf den ersten Blick erschließen. In “Weed Pin” etwa zerstört ein Typ aus Versehen einen Haufen Laborproben. Kindlon geht es dabei aber um Bedürfnis und Druck, einen annährend anständig bezahlten Job zu haben. Diese Außenseiter-freundliche Gedankenwelt geht Hand in Hand mit einem Sound, der nirgendwo so richtig reinpasst. Nick Cogan lässt seine Gitarre mal Power-Pop-Melodien von Culture Abuse jangeln, mal so misanthropisch stürmen wie bei Nothing. Mittlerweile hat die Band auch reichlich 90er-Alternative und Fugazi gehört – für Stagedives reicht es trotzdem noch.
Jonas Silbermann-Schön
Angel Du$t Pretty Buff

Ian Shelton sagt, dass es Militarie Gun ohne Angel-Du$t-Mastermind Justice Tripp vielleicht nicht gäbe. “Justice hat sich immer zur Zielscheibe gemacht und die Schüsse für alle anderen abgefangen, die in seinen Fußstapfen folgen. Also all diejenigen, die etwas Neues versucht haben, nachdem er es zuerst getan hat. Er ist der Tastemaker, die vielleicht einflussreichste Einzelperson im Hardcore von den frühen 2000ern bis heute.” Tripp hat sich in Bands wie Sai Nam, Trapped Under Ice und Warfare ausgetobt, ist als Gast auf Platten von Touché Amoré, Fiddlehead und Turnstile zu hören. Personalüberschneidungen mit letzteren gibt es bei Angel Du$t seit Anbeginn. Das Debüt “A.D.” überrascht 2014 zwischen traditionellem Hardcore und Indierock, “Rock The Fuck On Forever” setzt das 2016 fort, bis “Pretty Buff” ein neues Kapitel aufschlägt. Hardcore mit – vornehmlich – akustischen Instrumenten! Als hätten die Violent Femmes oder die Lemonheads sich an einer gutgelaunten NYHC-Platte versucht. Hier ist wirklich jeder Song ein Hit.
Jan Schwarzkamp
Hippie Trim Cult

Frischekick aus Frankfurt am Main: Hippie Trim bringen mit ihrem Debüt “Cult” eine neue Perspektive ins Genre. Auf seinen Hardcore schichtet das Quintett Shoegaze, Grunge, Dreampop und Pop-Punk, bleibt dabei aber so kompakt und wild wie ein Debüt sein sollte. Unter dem bellenden Gepose des Openers “Can’t Stop” schimmert Indie mit Sonnenbrille, vage Erinnerungen an Deafheavens “Sunbather” ploppen auf. Dieser Ansatz führt in gerade einmal 25 Minuten Spielzeit in beachtliche Soundbreiten: “Tools Will Be Tools” hantiert mit eigenwilligen Gitarrenschleifen, “Jersey Girls Don’t Pump Gas” taucht knietief in den Shoegaze und liefert halbminütlich Stimmungswechsel. “Join The Cult” ist vor dem Dreampop-Closer “All The Same” das Manifest der Platte, das weniger Presslufthammer und mehr Horizont verspricht. “Cult” ist eine Abkehr von Schema F, ein eigenwilliges Album mit Haltung ohne Arroganz und Patrick Kindlon von Drug Church als Gast und Resonanzfläche. Ein DIY-Kleinod, das die Individualität des Genres feiert.
Julia Köhler
Higher Power 27 Miles Underwater
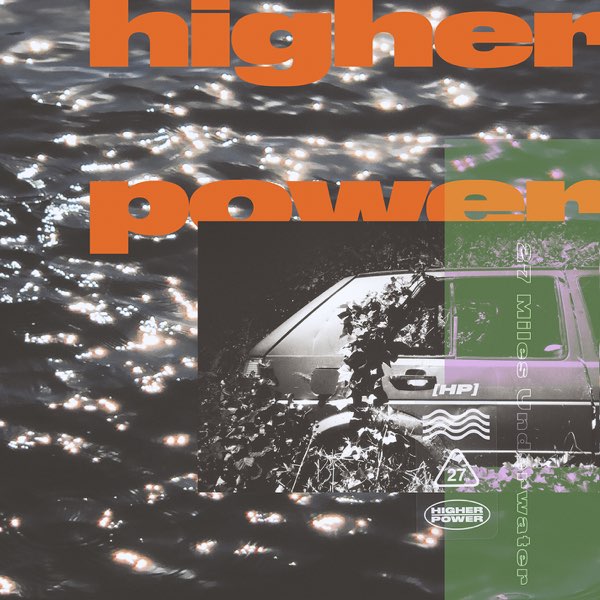
Bereits auf ihrem Demotape von 2015 reisen Higher Power zurück in die frühen 90er. Die Soundästhetik behält die Band aus Leeds auch auf ihrem für das Gallows-Label Venn aufgenommenen Debütalbum “Soul Structure” bei. Darauf reichen sich Leeway, Snapcase und Bad Brains circa “Quickness” (1989) die Hände: blecherne Snare, thrashige Grooves – alles konsequent oldschool. Auf “27 Miles Underwater” wird direkt im Opener “Seamless” klar, dass sich das alles auch noch dicker inszenieren lässt – ohne dabei die 90er-Verbindung zu kappen. Dabei hilft Produzent Gil Norton, der schon Jimmy Eat World, die Pixies und “The Colour And The Shape” der Foo Fighters produziert hat. Auch das größere Label passt: Roadrunner, die den Sound von Higher Power bereits in den 90ern hofiert haben. Auf “27 Miles Underwater” haben die Briten sich weiterentwickelt. Sie trauen sich mehr Melodie, mehr Deftones und Glassjaw, mehr Alternative Rock, mehr Grunge. 2024 folgten zwei Singles via Nuclear Blast. Seitdem ist es ruhig geworden.
Jan Schwarzkamp
Narrow Head 12th House Rock

Auf den ersten Blick grenzt es an 90er-Cosplay beziehungsweise Revisionismus, was Narrow Head aus Houston auf “12th House Rock” veranstalten. Es hat ikonische Bands wie Ride, My Bloody Valentine oder Teenage Fanclub nicht nur Anstrengungen, sondern auch größtenteils die Karriere gekostet, sich die damals gängigen Popsensibilitäten vom Leib zu halten – Narrow Head machen sich locker und all das Geschehene rückgängig, mit den Deftones und Pop als Bindegliedern. Noisy Gitarrenschichten, Garagen-Grunge, wundervolle Gesangslinien mischen sich in “Hard To Swallow” mit zarten Dissonanzen, in “Crankcase” mit angedeutetem Screamo und in “Night Tryst” mit Punkrock, dem Funk von Jane’s Addition und dem Galopp der Smashing Pumpkins. So klingt Dreampop von Menschen, die keine Lust zu schlafen haben, weil man da zu viel vom Leben verpassen würde. Von wegen Revisionismus: Das hier ist aus der Geschichte lernen, sie ins Jetzt zu verpflanzen und sonst unberührt zu lassen. Spoiler: Auf “Moments Of Clarity” (2024) gibt’s noch mehr Hits.
Michael Setzer
Fiddlehead Between The Richness

Fiddlehead aus Boston sind im Sinne dieser Liste vordergründig eine Band, die ein Feuer weiterträgt. Nicht nur personell in der Hinsicht, dass fast alle Mitglieder vorher bei Szenebands wie Basement oder Have Heart gespielt haben, sondern in erster Linie musikalisch. Etwa zehn Jahre nach den prägendsten Alben der “Wave” und dem kleinen Emo-Revival der frühen bis mittleren 2010er zehren Fiddlehead reichlich von diesen Einflüssen und bringen sie auf bestmögliche Weise zusammen. Selbst die grantigsten Schrei-Parts von Sänger Pat Flynn haben eine melodische Seele, die bittersüße klangliche Palette passt zum frühlingshaften Pastellkreiden-Artwork der Platte, die Kanten im Sound sind im Vergleich zum Debütalbum “Springtime And Blind” (2018) angeschliffen, aber definitiv nicht glatt. 2021 passt “Between The Richness” damit fast zu perfekt in die Title Fight-förmige Lücke im Herzen vieler Post-Hardcore-Fans, mit dem starken Nachfolger “Death Is Nothing To Us” (2023) haben Fiddlehead dort aber langsam Besitzrechte angemeldet.
Johannes Heese
Turnstile Glow On

Turnstile sind trotz starker Retrobezüge schon früh eine Band, die gerne ausschert und sich auf ihrem Debüt “Nonstop Feeling” (2015) und dessen Nachfolger “Time & Space” (2018) vorzugsweise vom Crossover der späten 80er inspirieren lässt. Es ist daher wahrscheinlich, dass sie mit der Idee, alles in einen Topf zu werfen, in ebenjenem Jahrzehnt Vorbilder fanden. Ihr drittes Album ist ein noch radikalerer Schnitt: Statt einer Sammlung einzelner Songs mit Farbtupfern hier und da ist “Glow On” ein Hardcore-Smoothie, in den alles rein darf, was gut ist – und bei dem man am Ende kaum wiedererkennt, woher die zahllosen Einflüsse ursprünglich kommen. Für viele Bands – etliche davon Teil dieser Liste – werden Turnstile damit zum kreativen Andockpunkt und “Glow On” für VISIONS das Album des Jahres 2021. Die Band selbst denkt den Spaß konsequent weiter: 2023 nimmt sie drei Songs des Albums mit dem Jazz-Kollektiv Badbadnotgood neu auf, auch das neue Album “Never Enough” bleibt abenteuerlich.
Johannes Heese
One Step Closer This Place You Know

Was tun, wenn man in direkter Nähe zur Heimatstadt von Title Fight aufwächst? Man gibt sein Bestes, um die musikalischen Fußstapfen zu füllen. Mit ihrem Debüt “This Place You Know” wagen One Step Closer zwar noch nicht so viele Experimente wie ihre (musikalischen) Nachbarn, können aber dennoch schnell Aufsehen erregen. Schließlich zieht nicht nur ihr Melodic Hardcore ab der ersten Sekunde von “I Feel So” in den Bann, in den Songs richtet die junge Band dann noch den Blick auf Themen wie Depressionen, Schicksalsschläge und Selbstentfremdung. Währenddessen hauchen sie ihrem Sound immer wieder ein Stückchen Emo ein, was besonders im experimentellen Hereafter deutlich wird. Entsprechend kann die Band um Frontmann Ryan Savitzki mit “This Place You Know” gleich beide Fanlager einsammeln und beweist schon in jungen Karrierejahren, wie man eine Hardcore-Platte produziert, die trotz teils hymnenhaften Ambitionen keine unnötigen Längen aufweist, sondern gleich zehnmal in knapp drei Minuten auf den Punkt kommt.
Nicola Drilling
Out Of Love So Far, So Good

Bisher sind uns Out Of Love noch ein Album schuldig. Aber die fünfköpfige Band aus London-Luton hat in den Corona-Jahren 2020 und 2021 gleich drei EPs veröffentlicht. Nicht irgendwo, sondern auf dem 2012 von den Gallows-Mitgliedern Laurent Barnard und Stu Gili-Ross ins Leben gerufenen Label Venn. Die Compilation “So Far, So Good” vereint diese ersten drei EPs zu einem spielfreudigen Album, das vor allem im Punk angesiedelt ist, getränkt mit grungigem Slacker-Pop. Der Flirt mit dem Hardcore äußerst sich insofern, dass die Gitarren satt und laut ballern, die Breaks Moshpit-tauglich sind und der Gesang gerne mal ins Shouting abdriftet. Hits gibt’s einige: das energische “Play Pretend”, das Weezer-eske “Bedbound” oder der abschließende, stürmische “Kill Song”. Mittlerweile haben Out Of Love drei weitere EPs veröffentlicht, darauf die Kinks und Oasis, Misfits und Green Day gecovert, ihre Artworks tiefer in die 90er manövriert und ihr Logo so zackig designt wie zuletzt Gel. Die Band wird immer besser. Zeit also für ein Album.
Jan Schwarzkamp
High Vis Blending
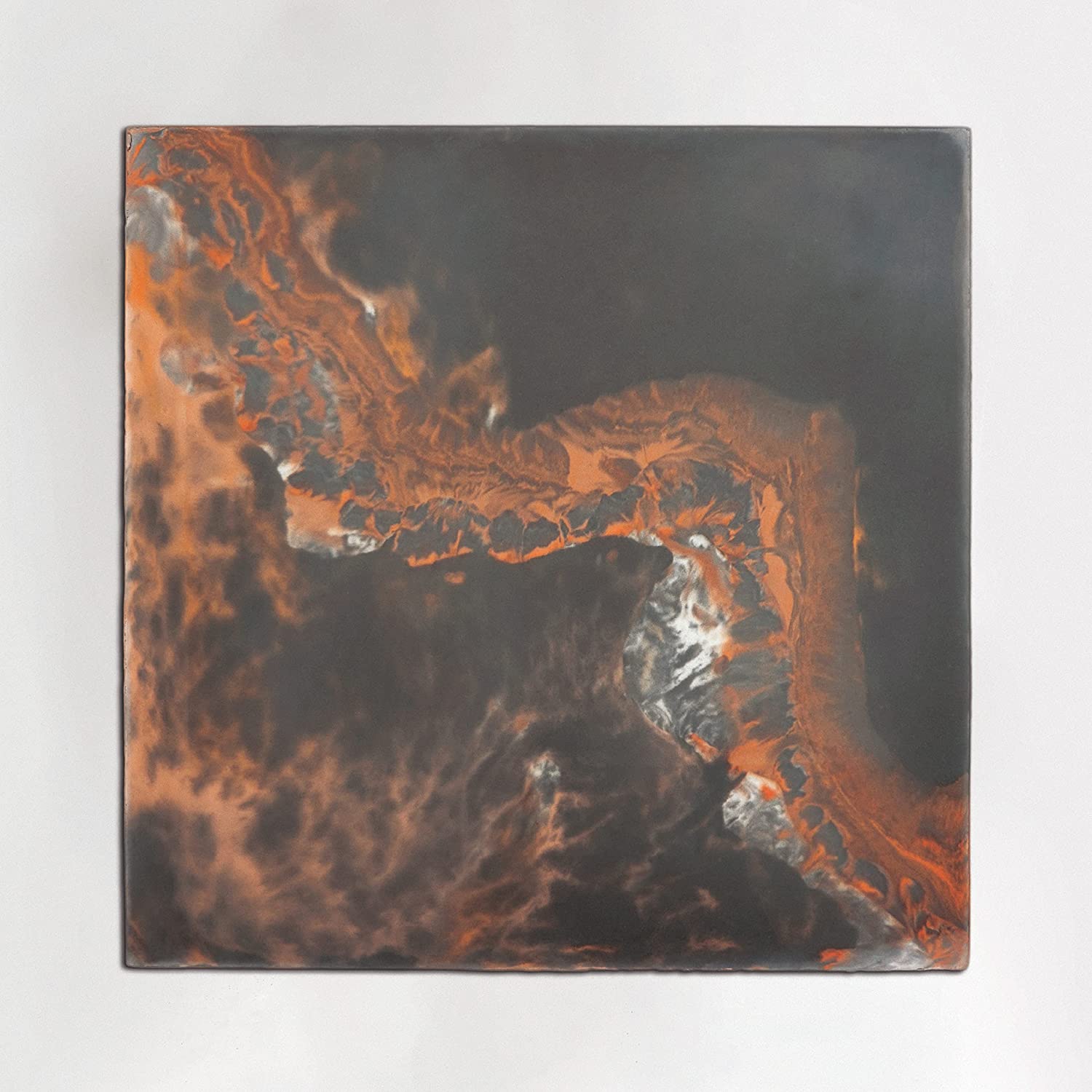
Mit überraschender Wärme und Zurückgenommenheit bündeln High Vis auf ihrem zweiten Album ihre Kräfte. Die Londoner haben sich die Wucht ihres Debüts “No Sense No Feeling” bewahrt und schwören nach wie vor auf bluthustendes Zornesgebell zu knüppelnden Riffs und harschen Grooves. Doch die Hoffnung, die Blending durchzieht, nimmt auf tröstende Art gefangen. Im Fokus auf die Spaltung der Gesellschaft und den Kampf gegen menschenverachtende politische und wirtschaftliche Strukturen, beschwören High Vis das Miteinander, die Gemeinschaft. Schon der Titel unterstreicht die notwendige Hinwendung zum Schönen in all dem, was kaputt macht. “Blending” sagt man im Liverpooler Slang, wenn sich jemand besonders schick macht. So schick, wie die Fusion aus Hardcore, Indie und sogar Britpop bis New Romantic, die High Vis hier eindrucksvoll etablieren und im Zuge dessen unterschiedliche Szenen vereinen, von der Nachtschicht in den Docks bis hinein ins hippe, aber hungernde Startup-Prekariat.
Ulf Imwiehe
Fleshwater We're Not Here To Be Loved

Minigolf, Börsenspekulation, Stricken oder Ju-Jutsu – ein Ausgleich zum Alltag ist seit jeher elementar, um die Kräfte wieder zu kanalisieren. Anthony DiDio, Matt Wood und Jeremy Martin von der widerborstigen Metalcore-Band Vein.fm aus Boston eröffnen sich 2017 mit Fleshwater eine solche Spielwiese: Post-Grunge oder -Nu-Metal irgendwo zwischen arg verträumten Deftones, den leider ziemlich untergegangenen Hum aus Illinois und wuchtigen Sunny Day Real Estate – Emo und Shoegaze mit Hardcore-Stiefeln, wenn man so will. Wie fein das alles auf ihrem Debüt zusammenpasst, liegt vornehmlich an Marisa Shirar, deren butterweiche Gesangsmelodien selbst unnötige Einzelteile wie kitschigen Stop-And-Go-Nu-Metal zusammenhält. In den besten Momenten wirkt diese harmonieverliebte 90er-Nostalgie wie der Moment, in dem sich die Sonne hinter einem Betonbau hervorschiebt. Und selbst in den schwächeren Momenten stecken Fleshwater gefallsüchtige 90er-Hitmaschinen wie Trapt oder Trust Company in die linke Hosentasche (hinten).
Michael Setzer
MSpaint Post-American
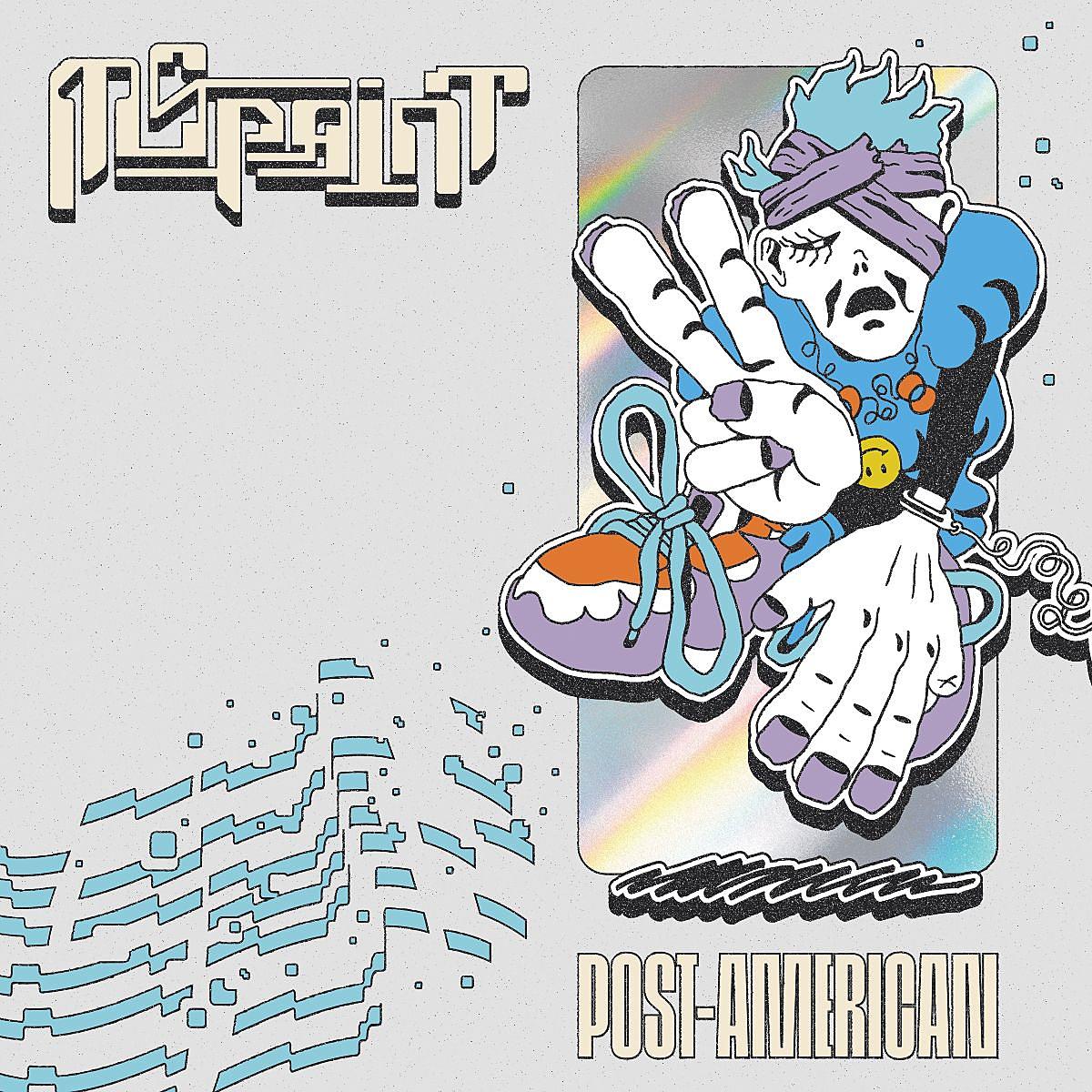
Klar, “Think It Through” würde mit herkömmlicher Instrumentierung über Herkömmlichkeit kaum hinausreichen. Die Sache ist eben die: Das Quartett aus Mississippi verzichtet zugunsten von vielfältigen Synthiesounds absichtlich auf Gitarren. Und die Dynamik nimmt hier gerade wegen der sägenden Synths von Nick Panella und Deedees energischem Sprechgesang Fahrt auf. Und davon lässt das Quartett auf seinem Debüt nicht mehr ab. Sagen wir: Crossover mit pulsierender Halsschlagader. Im sagenhaften “Decapitated Reality” mit Pierce Jordan von Soul Glo gipfelt das in einem Abriss aus Hardcore-Punk, gothigem Doom und finsterem HipHop, “Free From The Sun” entfaltet sich in direkter Nachbarschaft zu schöner Popmusik. Mit den USA hatten MSpaint bereits 2023 abgeschlossen –”Burn all the Flags and the Symbols of Man, Living out the Dream, Post-American”. Da wären wir nun. “Not a lot left to trust”, singt Deedee in “Flowers From Concrete”. Wir wären dann bereit für die Blumen. Oder Aufruhr. MSpaint liefern Energie für beides.
Michael Setzer
Scowl Psychic Dance Routine

Mit ihrer dritten EP tanzen Scowl nicht mehr nur auf dem Hardcore-Floor, sie reißen ihn auf. Fünf Songs lang zeigt die Band aus dem kalifornischen Santa Cruz, wie sich Genres dehnen lassen, ohne zu reißen. Produziert von Genreliebling Will Yip, wirken Scowl auf “Psychic Dance Routine”, als hätten sie das Chaos im Griff, indem sie Krach und Melodien versöhnen. Besonders wütend klingen sie in “Shot Down”, das gellendes Fauchen auf melodische Refrains prallen lässt. Immer wieder biegen die Songs in unvorhersehbare Gassen ab, wie der Titelsong, der Riot Grrrl mit Grunge-Flair, Power-Pop und eben Hardcore vermengt, der immer noch das Soundzentrum der Band ist. Daran erinnert am meisten die LoFi-Ästhetik von “Wired”. Kat Moss schreit dazu nicht, weil es laut sein muss – sie schreit, weil es sonst niemand versteht. “Psychic Dance Routine” sichert Scowl völlig zurecht den Platz in den Hypelisten der Szene. Yip produziert auch das diesjährige Album “Are We All Angels” – diese EP greift dem vor.
Julia Köhler
Gumm Slogan Machine

Drei Kleinformate via Bandcamp und Tape stellen für Gumm aus Chattanooga, Tennessee den Einstand dar. Von Anfang an verbinden sie die Wut und Verzweiflung des Hardcore mit Genre-fremden Elementen, etwa der Kühle des Post-Punk. Dazu kommen Artworks, die nicht als eindeutige Visitenkarte funktionieren. Ende 2021 veröffentlichen Gumm dann “No Frontier”, den Opener des erst anderthalb Jahre später erscheinenden Debütalbums “Slogan Machine”. Dem reichen acht Songs in 22 Minuten. Die erinnern an die ersten, noch aggressiveren EPs von Militarie Gun, mit denen Gumm auch als Support unterwegs sind. Sänger Drew Waldon bellt und brüllt und erinnert dabei manchmal an Ian Shelton und Patrick Kindlon. Überhaupt sind Gumm im Dreieck zwischen Militarie Gun und Drug Church bestens aufgehoben. Höhepunkt auf “Slogan Machine” ist das agile “Give You Back Your Youth” mit seinem Groove oder das mit 90er-Alternative-Elementen spielende “Crowded Mind”. Nun lautet die Frage, ob Gumm nach dem knackigen Einstand nachlegen können.
Jan Schwarzkamp
Militarie Gun Life Under The Gun

Schlimme Kindheit, gute Musik. Diese schlichte Formel, auf der ganze Rock’n’Roll-Mythen beruhen, trifft auch auf Militarie-Gun-Sänger Ian Shelton zu. Ein Aufwachsen in problematischen Verhältnissen destilliert er mit seinen Mitstreitern im Proberaum in Los Angeles in so berührende wie mitreißende Hymnen an den Dreck, der einen lähmen und vergiften kann, aus dem aber auch Schätze geborgen werden können, die man mit Geld nicht kaufen kann. Und das ist der Kern des ersten Albums dieser jungen und schon ganz zu Beginn ihrer Karriere erstaunlich reifen Band: Freundschaft, Zusammenhalt und das Loslassen, wenn es die Freiheit verlangt. Nach drei EPs setzen Militarie Gun mit “Life Under The Gun” ein Statement und führen Hardcore so nahe an den eingängigen und melancholischen College Rock aus längst vergangener Zeit heran, wie es nur möglich ist. Die Unity und Credibility wird hier nicht mit Karatetritten im Pit beschworen. Hier geht es um Liebe und den Mut, sich ihr hinzugeben. Gerade in schlimmen Zeiten.
Ulf Imwiehe
Gouge Away Deep Sage

Sorry, Ben Koller, aber es ist Zeit, den Drumhocker freizumachen. Denn Thomas Cantwell von Gouge Away ist wohl der patenteste und tighteste Schlagzeuger im modernen Hardcore. Wie wichtig der Rhythmus im Hardcore ist, beweist er auf der Gouge-Away-Comeback-Platte “Deep Sage”, die aufgrund der geografischen Distanz zwischen den Mitgliedern gar nicht existieren dürfte. Ein Glück, dass sie es tut. Denn darauf schärft die Band ihren Mix aus Noise-Gitarren und Post-Hardcore-Drive, der 2018 “Burnt Sugar” ausmacht, mit Hilfe von Szeneikone Jack Shirley nochmal ordentlich nach. Shoegaze wandert ebenso in den Mix wie 90er-Alternative, und auch das Tempo wird immer wieder rausgenommen, ohne dabei lahm zu werden. Etwa in “Newtau” und “Idealized”, die an die Post-Rock-Pioniere Slint erinnern. Der Closer “Dallas” ist dank der erstaunlich melodischen Singstimme von Christina Michelle und exzessivem Schellenkranzeinsatz dann fast schon Radiorock. “Deep Sage” zeigt, wie breit gefächert sich Hardcore auch heute noch aufstellen kann.
Florian Zandt



 Welle auf Welle
Welle auf Welle