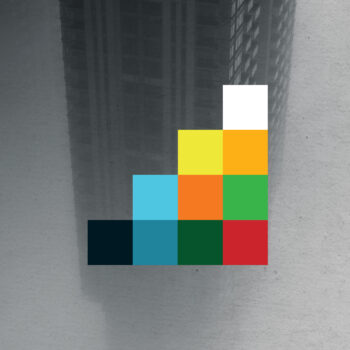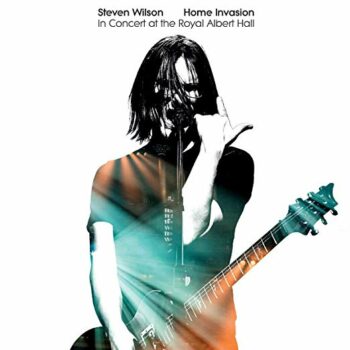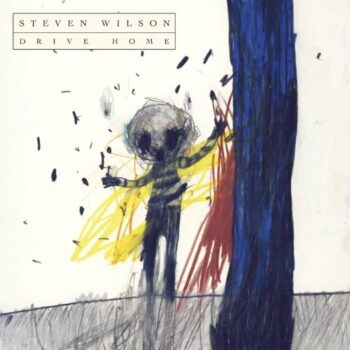Steven Wilsons zweites Soloalbum ist nicht ganz so gut wie das erste. Das war: Jammern auf hohem Niveau. Ein Heft mit 23 Seiten zu Pink Floyd ist auch ein gutes Heft, um über Steven Wilson zu sprechen (nicht zuletzt, weil Wilson als Kind über die Pink-Floyd-Platten seiner Eltern zur Musik gefunden hat). Progrock also auch auf dieser Seite. Progrock und die Frage, ob es cool oder nicht eher wahnsinnig prätentiös ist, Songs auf über 23 Minuten aufzublasen („Raider II“), sie einfach nicht enden lassen zu wollen („Like Dust I Have Cleared From My Eye“) oder, Beispiel „Sectarian“, mit Keyboards vollzukleistern, die nach dem Endkampf um Mittelerde klingen. Natürlich ist das nicht cool, es ist wahnsinnig prätentiös. Und elitär, abgehoben, überkandidelt. So wie alle großen Alben der großen Zeit des Prog: „Tarkus“ und „The Dark Side Of The Moon“, „Close To The Edge“ und „The Lamb Lies Down On Broadway“. Es ist aber nicht so wichtig, ob es prätentiös ist, solange es Emotionen weckt – so wie eine Punkplatte, ein Folkalbum oder ein Technotrack im besten Fall Emotionen wecken. Wichtig ist, dass man ein Album wie „Grace For Drowning“, das übrigens nicht ganz so gut geworden ist wie Wilsons Solodebüt „Insurgentes“ und sich im Vergleich dazu stärker am 70s-Prog orientiert, dass man es also hört und davon bewegt/berührt/begeistert wird. Scheiß auf ein paar überzogene Songminuten und die komischen Mittelerde-Keyboards: Dieses Songwriting und diese Stimme suchen ihresgleichen.
8/12 Dennis Plauk
Sogenannter Progressive Rock, eigentlich aber Musik für Oppas, die sich ihre guten Ohren bewahrt haben. Hier darf kein Tinnitus dazwischen stehen und schon gar keine Frequenz fehlen: Wer Steven Wilson hört, hört ihn wegen der feinen Sachen, dem Sound, der sich auch bei „Grace For Drowning“ erst für Leute entfaltet, die einen netten reichen Nachbarn haben, der sie mal seine Superanlage benutzen lässt. Wilson zerstört iPods, das haben wir alle schon mal gemacht, aber er filmt sich auch dabei, weil er eine Lektion erteilen oder zumindest eine Philosophie vermitteln will. Diese Philosophie ist schrecklich selbstgefällig und so uneinladend elitär wie der Gedanke, an einer Eliteuni zu studieren, sie beruht auf einem Vonobenherab, das sich einfach so in Nichts auflösen würde, wenn es kein Darunter gäbe, all die Bands, die ihre Instrumente nicht spielen können, keine Ahnung von Aufnahmetechnik haben und noch dazu zufälligerweise 20 Jahre jünger sind als Wilson. Ja. „Grace For Drowning“ ist dann eigentlich gar nicht so tragisch, ein Doppelalbum mit wirklich zu Herzen gehenden Momenten und viel heißer Luft auch, die aber überhaupt nicht schlimm wäre, wenn hier nicht der Anspruch auf Anspruch so viel größer wäre als das Ergebnis. Wilson ist nämlich auch nicht weniger retro als die Retrobands, die er verachtet, er bedient sich nur in einer anderen Ecke der 70er, und noch dazu in einer, in der ich nicht mal auf den Bus warten wollte, danke schön.
5/12 Daniel Gerhardt
weitere Platten
The Harmony Codex
VÖ: 29.09.2023
The Future Bites
VÖ: 29.01.2021
The B-Sides Collection (EP)
VÖ: 07.12.2020
Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall
VÖ: 02.11.2018
Last Day Of June (Soundtrack)
VÖ: 01.12.2017
To The Bone
VÖ: 18.08.2017
4 ½
VÖ: 22.01.2016
Transience
VÖ: 11.09.2015
Hand. Cannot. Erase
VÖ: 27.02.2015
Cover Version
VÖ: 27.06.2014
Drive Home (EP)
VÖ: 25.10.2013
The Raven That Refused To Sing (And Other Stories)
VÖ: 01.03.2013